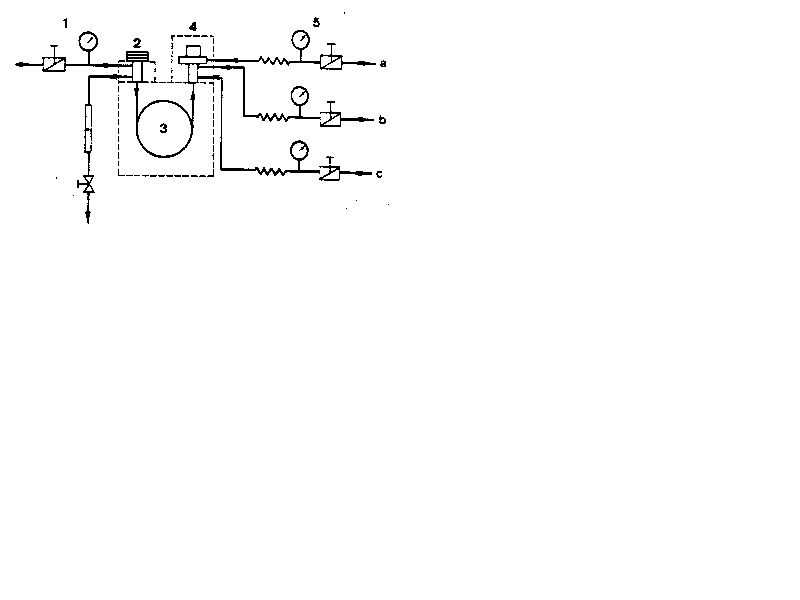Meßprinzip und Charakterisierung der Gaschromatographie
(TU-Dresden)
Die Gaschromatographie ist eine Methode, zur Trennung von Probengemischen.
Erfolgreiche Trennungen können mit Substanzen, die eine molekulare
Masse von 500 g/mol besitzen und einen Siedepunkt von unter 400°C besitzen,
durchgeführt werden. Die Proben werden beim Einspritzen (Injektion)
in die Gasphase überführt (mobile Phase) und mit einem Trägergas
in eine Säule getragen. In der Säule befindet sich eine feste
(stationäre) Phase (kann auch flüssig sein) mit der die Moleküle
in Wechselwirkung treten. Diese Wechselwirkungen beruhen auf physikochemischen
Kräften, die sich zwischen den Molekülen und der festen Phase
der Säule ausbilden. Dadurch entsteht ein bestimmte Verteilung der
Moleküle zwischen den beiden Phase. Diese Verteilung ist substanzspezifisch
und wird mathematisch durch den Verteilungskoeffizienten K ausgedrückt.
K = Konzentration in der stationären Phase/Konzentration in
der mobilen Phase
Stoffe, die sich in dem Verteilungskoeffizienten unterscheiden,
können getrennt werde. Das Einstellen einer solchen Verteilung benötigt
Zeit, sodaß im Vergleich eines Stoffes ohne Wechselwirkung mit der
Säule (K=0) die Analyten zurückgehalten (retardiert) und zu einem
späteren Zeitpunkt detektiert werden. Der Ort dieses Verteilungsgeschehens
wird als 'Boden' bezeichnet.
In einem Gaschromatographen werden alle Komponenten (Injektor,
Säule und Detektor) temperiert. Das Sälenmaterial besteht heute
überwiegend nur noch aus Kapillarsäulen, welche aus gezogenen
Glasphaserkapillaren bestehen. Dadurch werden große Längen,
eine hohe Anzahl von Böden und damit eine sehr gute Trennleistung
erzielt. Als Detektoren werden an den Geräten je nach Anwendungsgebiet
a) Wärmeleitfähigkeitsdetektoren (WLD),
b) Flammenionisationsdetektoren (FID),
c) Elektroneneinfang-detektoren (ECD) und
d) Stickstoff- Phosphor-Detektoren (FID-NP) benutzt.
In Kombination mit spektroskopishen Methoden könne n auch Infrarotspektrometer
oder Massenspektrometer eingesetzt werden.
Charakterisierung des Meßprinzipes:
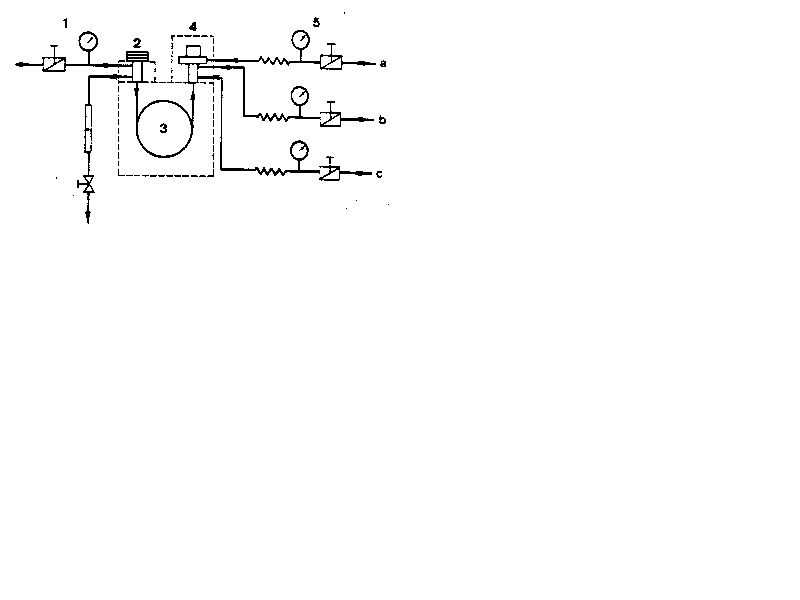
Wichtige Komponenten gaschromatographischer Systeme:
1 Trägergasversorgung, 2 Split- oder splitloser Injektor, 3
Säule, 4 Detektor (FID), 5 Gasversorgung für FID a) Luft, b)
Brenngas (Wasserstoff), c) Spülgas (Argon oder Stickstoff).
Aufgabenstellung/Versuchsdurchführung
Aufgabenstellung
Versuchsdurchführung
Aufgabenstellung:
-
Bestimmung des Nettoretentionsvolumens eines angegebenen Stoffpaares.
-
Berechnung der Anzahl theoretischer Böden N und des realen Bodens
n. Berechnung der theoretischen Bodenhöhen H und der realen Bodenhöhe
h.
-
Ermittlung der Peak-Auflösung eines Substanzpaares.
-
Qualitative Bestimmung des Benzol-Peaks in Benzin.
Versuchsdurchführung:
Sie finden die Apparatur (Trennofen) bei einer eingestellten Temperatur
(100 grad Celcius). Die Säule wird bereits mit einem vorgegebenen
Normaldruck des Trägergases durchspühlt. Stoppuhren und Injektionsspritzen
liegen bereit, ebenso die Gebrauchsanweisungen der Geräte.
-
Bei 7 verschiedenen Drucken wird mit Hilfe des Glasblasenzählers jeweils
3 mal je eingestelltem Druck die Volumengeschwindigkeit des Trägergases
bestimmt.
-
Bei 7 verschiedenen Drucken werden je 3 mal pro eingestelltem Druck die
Retentionszeit von Stadtgas und einem Stoffgemisch (Benzol-Toluol) bestimmt.
-
Bei einem von Ihnen gewãhlten Druck werden Benzin und vier Benzinproben
mit verschiedenen Benzolgehalten eingespritzt
Die Retentionszeit tr1 (retardere lat.: zurückhalten) ist
der Abstand eines Peakes vom Einspritzpunkt E auf der Zeitachse.
tR1 = to + t'R1
t'R1 = Netto-Retentionszeit des Stoffes (1). Aufenthaltszeit der Komponente
in der stationären Phase.
to = Totzeit. Aufenthaltszeit aller Komponenten in der mobilen
Phase.
Zur Bestimmung der Zeiten wird das Lot vom Peakmaximum eines symmetrischen
Peakes auf die Zeitachse gefällt.
Literatur
-
Wolfgang Gottwald;
GC für Anwender
Herausgeber U. Gruber, W. Klein; Verlag Chemie Weinheim 1995
-
G. Schomburg;
Gaschromatographie, Grundlagen, Praxis, Kapillartechnik
2. Auflage, Verlag Chemie Weinheim 1987
-
Analytikum
Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie Leipzig 1994
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.